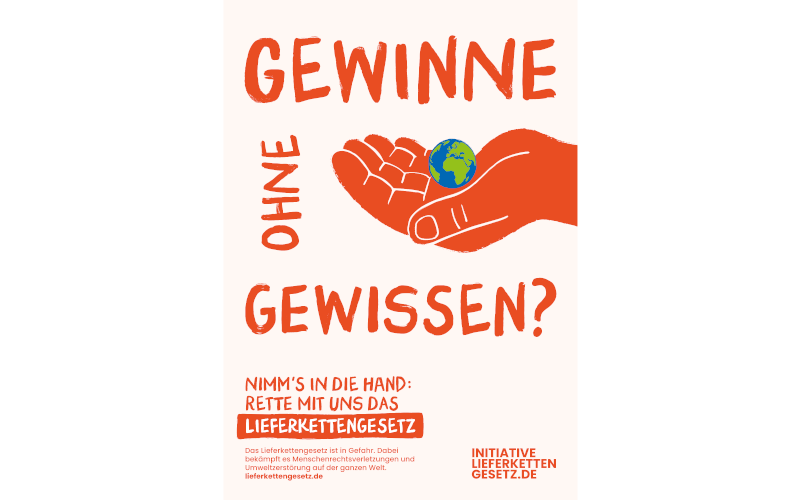Auf die Lieferkette
Mit guten Argumenten für ein starkes Lieferkettengesetz
Das deutsche Lieferkettengesetz (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, kurz LkSG) gilt seit Januar 2023 und verpflichtet große Unternehmen in Deutschland, die Menschenrechte und einige ausgewählte Umweltstandards in ihren Lieferketten zu achten. Hierzu gehört beispielsweise der Schutz vor Kinderarbeit und das Recht auf faire Löhne. Davor gab es keine gesetzlichen Regelungen, sondern nur freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen entlang internationaler Standards wie den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.
Konkret bedeutet das LkSG, dass große Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden sogenannte Sorgfaltspflichten umsetzen müssen: Sie müssen prüfen, ob es in ihren Lieferketten und bei ihren Lieferanten mögliche Risiken für Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden gibt. Und sie müssen dann dagegen Maßnahmen ergreifen. Das kann beispielsweise bedeuten, angemessene Löhne zu zahlen, die Arbeitssicherheit und den Brandschutz zu verbessern oder auch Schulungen für Mitarbeitende anzubieten. Kontrolliert und durchgesetzt wird die Einhaltung des Gesetzes durch das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
Auch auf EU-Ebene wurde im Mai 2024 eine Lieferkettenrichtlinie verabschiedet, kurz CSDDD verabschiedet. Die CSDDD muss von allen EU-Mitgliedsstaaten in nationales Recht überführt werden und sorgt so dafür, dass in der gesamten EU die gleichen Regeln gelten. Die Richtlinie betrifft allerdings deutlich weniger Unternehmen als das deutsche Gesetz. Dafür sieht sie eine zivilrechtliche Haftung von Unternehmen bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten vor, wenn dadurch konkreter Schaden entstanden ist. Betroffene von Menschenrechtsverletzungen bekommen dadurch einen besseren Zugang zumRecht und können in bestimmten Fällen vor europäischen Gerichten auf Schadenersatz klagen. Deutschland muss die Richtlinie noch in nationales Recht umsetzen und wird dafür voraussichtlich das LkSG an die CSDDD anpassen.
Die neue Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD schreibt in ihrem Koalitionsvertrag zum Lieferkettengesetz: „Wir schaffen das Lieferkettengesetz ab“. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Das LkSG wird nicht einfach abgeschafft, sondern es wird durch die Umsetzung der EU-Richtlinie ersetzt und bekommt dann den neuen Namen „Gesetz über die internationale Unternehmensverantwortung“.
Die EU-Kommission hat am 26. Februar 2025 einen Vorschlag für ein sogenanntes Omnibus-Paket vorgestellt. Die neuen Vorschläge würden die EU-Lieferkettenrichtlinie und andere Vorhaben aus dem Europäischen Green Deal massiv verwässern. Die EU-Kommission spricht von einer „Vereinfachung“ der Nachhaltigkeitspflichten – dabei dienen die meisten Vorschläge gar nicht der Vereinfachung, sondern greifen den Kern der Richtlinie an:
- So soll etwa die europaweite zivilrechtliche Haftung wieder gestrichen und Sanktionen sollen abgeschwächt werden. Betroffene von Menschenrechtsverletzungen würden damit eine wichtige Anspruchsgrundlage verlieren, vor Gerichten in Europa ihren Anspruch auf Schadenersatz einzuklagen. Aber nur ein Gesetz, das auch durchgesetzt werden kann, kann Wirkung entfalten.
- Außerdem soll nicht mehr von vornherein die gesamte Lieferkette in den Blick genommen werden, sondern der Fokus wie im deutschen Gesetz auf direkte Lieferanten gelegt werden. Dabei kommt es gerade am Anfang der Lieferkette zu den schwersten Menschenrechtsverletzungen.
- Ebenso sollen die Klimapläne der Unternehmen zur Einhaltung des 1,5 Grad-Limits nicht mehr verpflichtend umgesetzt werden. Ökonom*innen warnen, dass dadurch die Ziele des Pariser Klimaabkommens gefährdet werden und massive Klagerisiken für Unternehmen entstehen könnten.
Zusammengenommen würden diese Punkte die EU-Lieferkettenrichtlinie in ihrer Wirksamkeit stark einschränken und den Schutz der Menschenrechte beschneiden. Über den Omnibus-Vorschlag muss jetzt noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten, dem EU-Rat, abgestimmt werden. Danach müssen die drei EU-Institutionen in einem Trilog eine gemeinsame Position finden. Mit dem Start der Trilogverhandlungen wird im Herbst 2025 gerechnet.
Fakten und Argumente zum Lieferkettengesetz
Das Lieferkettengesetz und die EU-Richtlinie CSDDD sind Meilensteine zum Schutz von Menschenrechten, Umwelt und Klima – und werden doch von verschiedenen Seiten angegriffen. Hier liefern wir Argumente und Antworten auf die häufigsten Fragen in der aktuellen Debatte und räumen mit Falschbehauptungen auf.
Viele Menschenrechtsverstöße in Lieferketten sind seit langem bekannt. Freiwillige Initiativen seitens der Wirtschaft haben das Problem nicht lösen können. Und sie werden es auch in Zukunft nicht tun, denn:
- Unternehmen, die so billig wie möglich produzieren, haben auch weiterhin einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen, die ihren Sorgfaltspflichten nachkommen. Ohne gesetzliche und sanktionierbare Regelungen kommen Unternehmen ihrer unternehmerischen Verantwortung deshalb nicht ausreichend nach.
- Das belegen europaweite Studien ebenso wie eine 2020 veröffentlichte Unternehmensbefragung durch Ernst & Young im Auftrag der Bundesregierung. Sie ergab, dass nur 13-17 Prozent der untersuchten Unternehmen die menschenrechtlichen Anforderungen aus dem Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte erfüllen. Mehr als 83 Prozent der befragten Unternehmen hielten nicht einmal Kernelemente ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ein.
Das deutsche Lieferkettengesetz wirkt schon jetzt
Obwohl das LkSG erst seit kurzem gilt und die darin enthaltenen Pflichten auf langfristige strukturelle Verbesserungen abzielen, sind bereits positive Wirkungen sichtbar. Erfahrungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften und Betroffenen aus dem Globalen Süden zeigen: Bereits in der vergleichsweise kurzen Zeit von zwei Jahren hat das deutsche Lieferkettengesetz zu Verbesserungen geführt. So wurden in Ecuador erstmals Gewerkschaften angehört, um Ausbeutung auf Bananenplantagen zu stoppen, in China wurden Arbeitsbedingungen verbessert, und in mehreren Ländern Maßnahmen gegen Kinderarbeit eingeleitet.
Viele Unternehmen sagen Ja zum Lieferkettengesetz
Die Mehrheit der deutschen Unternehmen befürwortet die gesetzliche Verankerung von Sorgfaltspflichten und kommt mit den Anforderungen des deutschen Lieferkettengesetzes bereits gut zurecht. Das zeigen diverse Studien und Umfragen.
- So sind laut einer groß angelegten unabhängigen Studie des Handelsblatt Research Institute aus dem Jahr 2024 nur sieben Prozent der Unternehmen dagegen, zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten verpflichtet zu werden. Die große Mehrheit der Unternehmen sieht betriebswirtschaftliche Vorteile durch die Einhaltung von Sorgfaltspflichten.
- Eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag des Jaro Instituts aus dem Mai 2025 zeigt, dass nur acht Prozent der deutschen Unternehmen dafür sind, die geltenden Sorgfaltspflichten zu reduzieren. Eine Mehrheit auch der kleinen und mittelständischen Unternehmen befürwortet weiter die EU-Lieferkettenrichtlinie.
- Die meisten Unternehmen sehen in verbindlichen Sorgfaltspflichten Chancen, Nachhaltigkeit bei sich im Unternehmen voranzutreiben: Das zeigt zum Beispiel eine Studie des Wirtschaftsverbands BME, der über 10.000 Unternehmen vertritt.
- Viele Unternehmen haben sich öffentlich in verschiedenen Unternehmensstatements für das Lieferkettengesetz und gegen eine Öffnung der CSDDD ausgesprochen. In dieser Weise öffentlich positioniert haben sich beispielsweise Bayer, Aldi Süd, IKEA, Nestlé, Tchibo, Vattenfall, Unilever, Otto, Hapag-Lloyd, Primark und viele andere mehr. Die Unterstützung reicht von großen multinationalen Konzernen bis zu kleinen Mittelständlern etwa aus dem Maschinenbau.
Viele deutsche Unternehmen unterstützen das Lieferkettengesetz und die EU-Lieferkettenrichtlinie auch aus eigenem Interesse: Sie erwarten Rechtssicherheit, Wettbewerbsgleichheit und langfristig auch steigende Umsätze, da es durch die EU-Richtlinie endlich klare und einheitliche Regeln gibt, die sich an internationalen Richtlinien orientieren.
Eine Aushöhlung oder Abschaffung der Gesetze würde für weitere Unsicherheit unter den Unternehmen sorgen. Es würde nur die Unternehmen belohnen, die die gesetzlichen Verpflichtungen bisher einfach ignoriert haben. Bestraft würden Unternehmen, die sich bereits erfolgreich auf den Weg gemacht haben, Sorgfaltspflichten umzusetzen.
Das Lieferkettengesetz schützt unbürokratisch und sehr konkret Menschenrechte und Umwelt
Manche versuchen, das Lieferkettengesetz als „überbordende Bürokratie“ oder als reine „Berichtspflichten“ zu verunglimpfen – dabei geht es um Regeln zum Schutz von Menschenrechten, Umwelt und Klima. Der aus den internationalen Standards übernommene Ansatz der „Sorgfaltspflichten“ ermöglicht es Unternehmen, flexibel im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf Risiken in ihren Lieferketten zu reagieren.
- Das Lieferkettengesetz folgt einem risikobasierten Ansatz: Statt alle Zulieferer zu kontrollieren, sollen sich Unternehmen auf die gravierendsten Risiken konzentrieren – und die liegen meist am Anfang der Lieferkette, etwa auf Plantagen, in Minen oder Textilfabriken. Es geht also nicht um sinnlose Berichte, sondern um einzelne (aber häufig strukturelle) Fälle sehr konkreter Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung, die mit der Geschäftspraxis der Unternehmen in Europa zusammenhängen.
- Die EU-Lieferkettenrichtlinie enthält gar keine neuen oder überlappenden Berichtspflichten. Ganz im Gegenteil: Unternehmen sollen künftig nur nach den ohnehin schon geltenden Regeln der Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) berichten. Für die von der EU-Kommission angeblich angestrebte Harmonisierung und Reduzierung von Berichtspflichten wäre es daher unnötig und falsch, die CSDDD noch einmal aufzumachen.
- Deutsche Unternehmen haben das LkSG längst umgesetzt und funktionierende Prozesse etabliert. Sie sind daher auch auf die EU-Richtlinie vorbereitet - denn die CSDDD knüpft stark an das LkSG an. Deutsche Unternehmen haben daher bei der Umsetzung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen EU-Unternehmen.
Kleine und mittelständische Unternehmen fallen weder unter das deutsche noch das europäische Gesetz. Die CSDDD gilt nur für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem weltweiten Nettojahresumsatz von mindestens 450 Millionen Euro. In Deutschland betrifft das 1.000 Unternehmen und damit unter 0,05% der deutschen Unternehmen.
Richtig ist allerdings, dass es teilweise durch eine falsche Anwendung des Gesetzes zu einer Belastung eigentlich nicht vom Gesetz erfasster, kleiner und mittlere Unternehmen (KMU) kommt: Es gibt das Problem, dass große Unternehmen, die unter das deutsche Lieferkettengesetz fallen, komplexe Fragebögen und Vertragsklauseln an ihre kleineren Lieferanten schicken. Damit wollen es sich große Unternehmen einfach machen und sich aus ihrer Verantwortung stehlen. Die kleinen Lieferanten, die selbst nicht direkt unter das Gesetz fallen, sind damit teilweise überfordert. Das ist aber eine falsche Anwendung und Umsetzung des LkSG und so im Gesetz nicht vorgesehen.
Das Gesetz fokussiert auf die größten Risiken – nicht auf jede Schraube
Die EU-Lieferkettenrichtlinie schreibt nicht vor, dass Unternehmen ihre gesamte Lieferkette transparent machen oder gar jeden ihrer Zulieferer kontrollieren müssen. Ein solches Vorgehen wäre sogar eine falsche Anwendung der CSDDD.
- Die Richtlinie folgt einem risikobasierten Ansatz. Das heißt: Unternehmen sollen dort aktiv werden, wo es Indizien für Missstände gibt. Dabei dürfen sie priorisieren: Je nach ihren Möglichkeiten können sie entscheiden, sich zunächst auf einige schwerste Menschenrechtsrisiken zu konzentrieren und die übrigen Risiken zu depriorisieren.
- Außerdem gibt es keine Erfolgspflicht, sondern die Pflicht, sich angemessen zu bemühen. Unternehmen sollen sich anstrengen, sie müssen aber nichts Unmögliches leisten.
Was jetzt geschehen muss
- Die europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) darf nicht verwässert werden. Die zivilrechtliche Haftung muss erhalten bleiben, damit Betroffene von Menschenrechtsverletzungen weiterhin einen Zugang zu Recht haben. Es braucht den risikobasierten Ansatz, um die schwerwiegendsten Risiken in den Lieferketten in den Fokus nehmen zu können. Unternehmen müssen bei Verstößen mit Bußgeldern rechnen können, die sich an ihrem Umsatz orientieren. Und die Klimapläne müssen von den Unternehmen auch umgesetzt werden, um nicht nur unnötiges Papier zu produzieren.
- Das deutsche Lieferkettengesetz darf jetzt nicht mehr abgeschwächt oder gar ausgesetzt werden. Es muss bis zur Umsetzung der CSDDD in Deutschland gelten und bis dahin in vollem Umfang erhalten bleiben.
- Die CSDDD muss zügig in deutsches Recht umgesetzt werden, um Rechtssicherheit und ein Level-Playing-Field für die deutschen Unternehmen zu schaffen. Dabei darf das aktuell geltende Niveau des Menschenrechtsschutzes in Deutschland nicht abgesenkt werden.
- Es muss verstärkt darauf geachtet werden, dass die Gesetze nicht weiter falsch angewendet werden. Zentral ist, dass der Gesetzgeber dafür sorgen muss, dass keine falschen Einheitsfragebögen und einseitige Vertragsklauseln einfach an kleine Unternehmen weitergereicht werden.
Die ungekürzte Fassung dieser Argumente und Forderungen für den Erhalt und die Stärkung des Lieferkettengesetzes finden Sie unter: www.lieferkettengesetz.de
Die Initiative Lieferkettengesetz wird von über 90 Menschenrechtsorganisationen, Umweltverbänden, Gewerkschaften, kirchlichen und entwicklungspolitischen Organisationen getragen